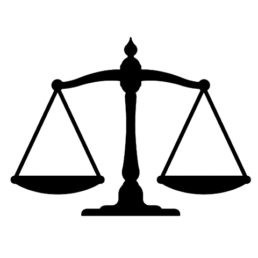Sportrecht – EuGH zur Super League
Sportrecht – EuGH zur Super League
Der Europäische Gerichtshof verhandelt am heutigen Montag über die bisher gescheiterten Pläne mehrerer Fußballclubs zur Gründung einer neuen Superliga. Die Luxemburger Richtern sollen die Frage klären, ob der Weltverband FIFA und die Europäische Fußball-Union UEFA als Kartell handeln und ihre beherrschende Stellung missbrauchen. Dazu solle festgestellt werden, inwiefern das Sportmodell der Verbände mit dem europäischen Wettbewerbsrecht in Widerspruch steht.
Dieselskandal Mercedes Benz – Verfahren über Musterfeststellungsklage beginnt
Dieselskandal Mercedes Benz – Verfahren über Musterfeststellungsklage beginnt
Am morgigen Dienstag beginnt am Oberlandesgericht Stuttgart die Verhandlung um die Musterfeststellungsklage (MFK) des Verbraucherzentrale Bundesverbands gegen Mercedes-Benz. Dem Autobauer wird eine bewusste Manipulation von Abgaswerten vorgeworfen. Er soll deshalb den Diesel-Käufern Schadensersatz zahlen. Der MFK haben sich bis Ende Juni ca. 2804 Käuferinnen angeschlossen. Es ist die zweite MFK gegen einen Autobauer im Zusammenhang mit dem Dieselskandal und Käuferrechten. 2018 hatte der Verbraucherzentrale Bundesverband bereits VW verklagt. Das Verfahren gegen VW endete mit einem Vergleich, den rund 245.000 Käuferinnen akzeptierten.
Bei der Geltendmachung und Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen gegenüber Mercedes Benz und anderen Automobilherstellern stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Verkehrsrecht – Falle Vorrang „rechts vor links“ auf Baumarktparkplatz
Verkehrsrecht – Falle Vorrang „rechts vor links“ auf Baumarktparkplatz
Auf Fahrgassen eines Parkplatzes, die vorrangig der Parkplatzsuche dienen und nicht dem fließenden Verkehr, gilt nicht die Vorfahrtsregel „rechts vor links“. Die Fahrer sind vielmehr verpflichtet, defensiv zu fahren und die Verständigung mit dem anderen Fahrer zu suchen. Das OLG Frankfurt am Main hat in seiner Entscheidung eine hälftige Haftungsquote für die Unfallfolgen auf einem Parkplatz eines Baumarktes ausgesprochen.
OLG Frankfurt am Main, Urteil vom 07.07.2022, AZ: 17 U 21/22
Hintergrund
Der Kläger begehrt restlichen Schadensersatz nach einem Verkehrsunfall. Der Unfall ereignete sich auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Wiesbaden. Der Betreiber hatte die Geltung der StVO angeordnet. Auf die zur Ausfahrt des Parkplatzgeländes führende Fahrgasse münden von rechts mehrere Fahrgassen ein. Der Beklagte befuhr eine dieser von rechts auf die Ausfahrgasse einmündenden Fahrgassen, an deren beiden Seiten sich im rechten Winkel angeordnete Parkboxen befanden. Auch die zur Ausfahrt führende Fahrgasse verfügt im linken Bereich über Parkboxen. Im Einmündungsbereich der Fahrgassen kam es zum Zusammenstoß mit dem klägerischen Fahrzeug.
Hälftige Haftung
Das Landgericht hat der Klage auf Basis einer Haftung des Beklagten in Höhe von 25 % stattgegeben. Die hiergegen gerichtete Berufung des Klägers führte zu einer Abänderung der Haftungsquote auf 50 %. Maßgeblich für die Höhe der Schadensersatzverpflichtung des Beklagten sei, inwieweit der Schaden vorwiegend von dem einen oder anderen Teil verursacht worden sei, so der Frankfurter Richter. Die Verursachungsbeiträge der Fahrer der unfallbeteiligten Fahrzeuge seien hier als gleichgewichtig anzusehen und der durch den Unfall verursachte Schaden zu teilen.
Der Beklagte könne auch nicht geltend machen, dass sein Vorfahrtsrecht verletzt wurde. Zwar seien die Regeln der Straßenverkehrsordnung auf öffentlich zugänglichen Privatparkplätzen wie hier grundsätzlich anwendbar. Fahrgassen auf Parkplätzen seien jedoch keine dem fließenden Verkehr dienenden Straßen und gewährten deshalb keine Vorfahrt. Kreuzen sich zwei dem Parkplatz zum Verkehr nicht dienende Fahrgassen eines Parkplatzes, gilt für die herannahenden Fahrzeugführer das Prinzip der gegenseitigen Rücksichtnahme. Das heißt, jeder Fahrzeugführer ist verpflichtet, defensiv zu fahren und die Verständigung mit dem jeweils anderen Fahrzeugführer zu suchen, so das OLG.
Etwas anderes gilt nur, wenn die angelegten Fahrspuren eindeutig und unmissverständlich Straßencharakter hätten und sich bereits aus ihrer baulichen Anlage ergäbe, dass sie nicht der Suche von freien Parkplätzen dienten, sondern der Zu- und Abfahrt der Fahrzeuge. Für einen solchen Straßencharakter könne etwa die Breite der Fahrgasse sprechen oder auch bauliche Merkmale einer Straße wie Bürgersteige, Randstreifen oder Gräben. Derartige straßentypische bauliche Merkmale fehlten hier. Die Fahrgassen dienten ersichtlich nicht dem fließenden Verkehr, da an ihnen jeweils Parkboxen angeordnet worden.
Da es am Straßencharakter auch für die vom Klägerfahrzeug befahrene Fahrgasse fehle, habe der Beklagte auch nicht die hohen Sorgfaltsanforderungen beim Einfahren auf eine Fahrbahn im Sinne des § 10 StVO erfüllen müssen.
Die Entscheidung zeigt deutlich, dass bei der Parkplatzsuche erhöhte Vorsicht geboten ist. Soweit Fahrstreifen auf einem Parkplatz vorhanden sind, die der Parkplatzsuche dienen, gilt kein „rechts vor links“.
Unsere auf das Verkehrsrecht spezialisierten Anwälte stehen Ihnen bei der Abwicklung von Verkehrsunfällen sowie der Geltendmachung von Schadensersatz- und Schmerzensgeldansprüche sowie dessen Abwehr kompetent zur Verfügung.
Arbeitsrecht – Gewerkschaften scheitern vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte
Arbeitsrecht – Gewerkschaften scheitern vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg hat die Klage von mehreren Gewerkschaften gegen das deutsche Tarifeinheitsgesetz abgewiesen. Dieses Gesetz sieht vor, dass in einem Unternehmen mit zwei Gewerkschaften nur der Tarifvertrag der mitgliederstärkeren Arbeitnehmervertretung angewendet wird. „Ein Betrieb – Tarifvertrag“ wird dieser Grundsatz genannt. Kleinere Gewerkschaften wie die Ärztevertretung Marburger Bund und die Lokführergewerkschaft GDL fürchteten eine Schwächung ihrer Position und beklagten einen Verstoß gegen das Recht, sich in Gewerkschaften zusammenzuschließen. Das Bundesverfassungsgericht entschied im Jahr 2017, dass das Tarifeinheitsgesetz mit dem Grundgesetz vereinbar sei.
Die Beschwerden der Gewerkschaften hat nun auch der EGMR zurückgewiesen. So sei ein Verstoß gegen die Menschenrechtskonvention nicht ersichtlich, da den kleineren Gewerkschaften noch andere Rechte blieben, wie zum Beispiel Tarifverhandlungen oder Streiks, so die Auffassung der Straßburger Richter.
Unsere auf das Arbeitsrecht spezialisierten Anwälte stehen Ihnen bei sämtlichen Fragestellungen des Tarifrechts kompetent zur Verfügung.
Arbeitsrecht – EuGH verweist Streit um Nachtzuschläge zurück an das Bundesarbeitsgericht
Arbeitsrecht – EuGH verweist Streit um Nachtzuschläge zurück an das Bundesarbeitsgericht
Hintergrund
Zwei Mitarbeiter von Coca-Cola, die Nachtarbeit im Schichtbetrieb geleistet hatten, haben geklagt. Sie machten vor den nationalen Arbeitsgerichten eine Ungleichbehandlung geltend, da nach dem Manteltarifvertrag für regelmäßige Nachtarbeit nur 20 % Zuschlag gezahlt werden, während der Zuschlag für unregelmäßige Nachtarbeit bei 50 % liegt. Dies vor dem Hintergrund, dass die unregelmäßige Nachtarbeit belastender ist, als die regelmäßige Nachtarbeit.
Das Bundesarbeitsgericht hatte sich Ende 2020 mit Fragen an den EuGH gewandt, ob mit einer tarifvertraglichen Regelung, die für unregelmäßige Nachtarbeit einen höheren Vergütungszuschlag vorsieht als für regelmäßige Nachtarbeit, die Arbeitszeitrichtlinie 2003/88 im Sinne von Artikel 51 Abs. 1 der Charta durchgeführt wird.
EuGH – Vergütungszuschlag fällt nicht unter Arbeitszeitrichtlinie
Der EuGH verneinte die Anwendbarkeit der Arbeitszeitrichtlinie. Die Richtlinie würde zwar Bestimmungen über Nachtarbeit enthalten, diese beträfen jedoch nur Dauer und Rhythmus, den Gesundheitsschutz und die Sicherheit der Nachtarbeiter sowie die Unterrichtung der zuständigen Behörden. Sie regelt also nicht das Entgelt der Arbeitnehmer für Nachtarbeit und erläge den Mitgliedsstaaten folglich in Bezug auf die hier in Rede stehenden Sachverhalte keine spezifische Verpflichtung auf. Der im Manteltarifvertrag vorgesehene Vergütungszuschlag falle folglich nicht unter die Richtlinie und könne nicht als Durchführung des Unionsrechts angesehen werden.
Der EuGH hat den Streit daher zurück nach Deutschland an das BAG zur Entscheidung verwiesen.
Wettbewerbsrecht - OLG München zum Weiterverkaufsverbot von Wies´n-Reservierungen
Wettbewerbsrecht - OLG München zum Weiterverkaufsverbot von Wies´n-Reservierungen
Eine Eventagentur handelt unlauter, wenn sie Reservierungen für ein Oktoberfestzelt weiterverkauft, so das OLG München mit Urteil vom 07.07.2022 – 6 U 7831/21.
Hintergrund
Hintergrund dieser Entscheidung war, dass die Betreiber des Festzeltes Ochsenbraterei eine Eventagentur verklagt haben, da diese Reservierungen von Dritten abkaufte und sie dann für sehr viel mehr Geld auf einer Online-Seite zum Weiterverkauf anbot. So kosten Reservierungen im Zelt selbst maximal € 400,00 für einen Tisch mit zehn Personen, auf der Online-Plattform der Agentur hingegen zwischen € 1.990,00 und € 3.299,00. Hinzu kommt, dass in den Reservierungsbedingungen der Ochsenbraterei unter anderem festgeschrieben ist, dass die Reservierung nicht an Dritte übertragen werden darf. Auch ist es nach den Bedingungen verboten, Reservierungen oder Reservierungsbändchen zu überhöhten Preisen oder mit unmittelbarer Gewinnerzielungsabsicht weiter zu verkaufen oder zum Kauf anzubieten. Bei einem Verstoß dagegen besteht laut den Bedingungen keine Pflicht, einem Inhaber der Reservierungsbestätigung, der nicht Vertragspartner der Ochsenbraterei ist, Plätze zur Verfügung zu stellen.
Die Ochsenbraterei klagte daher und machte wettbewerbsrechtliche Unterlassungs-, Auskunfts- und Schadensersatzansprüche geltend.
Das Landgericht München I hatte der Klage in erster Instanz voll umfänglich stattgegeben. Nach Ansicht der Münchner Richter nimmt die Eventagentur eine irreführende geschäftliche Handlung vor, in dem sie die Erwerber der Tischreservierungen darüber täuschte, in der Lage zu sein, dem Erwerber einen wirksamen und rechtlich durchsetzbaren Anspruch auf einen reservierten Platz im Festzelt der Ochsenbraterei zu verschaffen, was tatsächlich nicht der Fall sei.
OLG München bestätigt Unterlassungsanspruch
Nach Ansicht des OLG München ist der Weiterverkauf der Tickets irreführend und damit unlauter gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb (UWG).
Ob eine Irreführung vorliegt, richte sich maßgeblich danach, wie der angesprochene Verkehr das Angebot aufgrund seines Gesamteindrucks versteht, so die Münchner Richter. Ein Sachverständigengutachten zur Ermittlung des Verkehrsverständnisses hielt das OLG für überflüssig. Der Senat kann die Verkehrsauffassung aus eigener Sachkunde beurteilen, da seine Mitglieder selbst zu den angesprochenen Verkehrskreisen gehören, heißt es im Urteil. Der Ochsenbraterei steht demnach ein Unterlassungsanspruch zu. Allerdings hat die Ochsenbraterei keinen Anspruch auf Drittauskunft. In der ersten Instanz wurde die Agentur noch dazu verurteilt, den Festzeltbetreibern Auskunft über Namen und Anschrift der Ersterwerber bzw. Zwischenhändler zu erteilen, von welchen sie die angebotenen Reservierungen angekauft hatten. Nach Ansicht des OLG sei nicht ersichtlich, inwiefern die begehrten Auskünfte geeignet und erforderlich wären, um künftige Rechtsverletzungen durch Verschließen der Bezugsquelle zu verhindern. Auch würde eine Schadensersatzpflicht nicht bestehen, da es an der erforderlichen Wahrscheinlichkeit eines Schadens fehle.
Arbeitsrecht – BAG zur Darlegungs- und Beweislast im Überstundenvergütungsprozess
Arbeitsrecht – BAG zur Darlegungs- und Beweislast im Überstundenvergütungsprozess
Sachverhalt
Der Kläger war als Auslieferungsfahrer bei der Beklagten, die ein Einzelhandelsunternehmen betreibt, beschäftigt. Seine Arbeitszeit erfasste der Kläger mittels technischer Zeitaufzeichnung, wobei nur Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit, nicht jedoch die Pausenzeiten aufgezeichnet wurden. Zum Ende des Arbeitsverhältnisses ergab die Auswertung der Zeitaufzeichnungen einen positiven Saldo von 348 Stunden zu Gunsten des Klägers. Mit seiner Klage hat der Kläger Überstundenvergütung in Höhe von € 5.222,67 brutto verlangt. Er hat geltend gemacht, er habe die gesamte aufgezeichnete Zeit gearbeitet. Pausen zu nehmen, sei nicht möglich gewesen, da sonst die Auslieferungsaufträge nicht hätten abgearbeitet werden können. Die Beklagte hat dies bestritten.
Arbeitsrecht Emden gibt Klage statt.
Das Arbeitsgericht meinte, dass durch das Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) vom 14.05.2019 – C-55/18, wonach die Mitgliedsstaaten die Arbeitgeber verpflichten müssen, ein objektives, verlässliches und zugängliches Arbeitszeiterfassungssystem einzuführen, die Darlegungslast im Überstundenvergütungsprozess modifiziert wird. Die positive Kenntnis von Überstunden als eine Voraussetzung für deren arbeitgeberseitige Veranlassung sei jedenfalls dann nicht erforderlich, wenn der Arbeitgeber sich die Kenntnis durch Einführung, Überwachung und Kontrolle der Arbeitszeiterfassung hätte verschaffen können. Ausreichend für eine schlüssige Begründung der Klage sei, die Zahl der geleisteten Überstunden vorzutragen. Da die Beklagte ihrerseits nicht hinreichend konkret die Inanspruchnahme von Pausenzeiten durch den Kläger dargelegt habe, sei die Klage begründet.
Landesarbeitsgericht ändert Urteil ab
Das Landesarbeitsgericht hat das Urteil des Arbeitsgerichtes abgeändert und mit Ausnahme bereits von der Beklagten abgerechneter Überstunden abgewiesen. Die hiergegen gerichtete Revision des Klägers hatte vor dem fünften Senat des Bundesarbeitsgerichts keinen Erfolg. Das Berufungsgericht hat richtig erkannt, dass vom Erfordernis der Darlegung der arbeitgeberseitigen Veranlassung und Zurechnung von Überstunden durch den Arbeitnehmer auch nicht vor dem Hintergrund der genannten Entscheidung des EuGH abzurücken ist. Diese ist zur Auslegung und Anwendung der Arbeitszeitrichtlinie 2003/88/EG und von Artikel 31 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union ergangen. Nach gesicherter Rechtsprechung des EuGH beschränken sich diese Bestimmungen darauf, Aspekte der Arbeitszeitgestaltung zu regeln und den Schutz der Sicherheit und der Gesundheit der Arbeitnehmer zu gewährleisten. Sie finden indes grundsätzlich keine Anwendung auf die Vergütung der Arbeitnehmer. Die unionsrechtlich begründete Pflicht zur Messung der täglichen Arbeitszeit hat deshalb keine Auswirkung auf die nach deutschem materiellen und Prozessrecht entwickelten Grundsätze über die Verteilung der Darlegungs- und Beweislast im Überstundenvergütungsprozess. Hiervon ausgehend hat das Landesarbeitsgericht zutreffend angenommen, der Kläger habe nicht hinreichend konkret dargelegt, dass es erforderlich gewesen sei, ohne Pausenzeiten durchzuarbeiten, um die Auslieferungszeiten zu erledigen. Die bloße pauschale Behauptung ohne nähere Beschreibung des Umfangs der Arbeiten genügt hierfür nicht. Das Berufungsgericht konnte daher offen lassen, ob die von der Beklagten bestrittene Behauptung des Klägers, er habe keine Pausen gehabt, überhaupt stimmt.
Fazit
Der Arbeitnehmer hat also zur Begründung einer Klage auf Vergütung geleisteter Überstunden erstens darzulegen, dass er Arbeit in einem die Normalarbeitszeit übersteigenden Umfang geleistet oder sich auf Weisung des Arbeitgebers hierzu bereit gehalten hat. Da der Arbeitgeber Vergütung nur für von ihm veranlasste Überstunden zahlen muss, hat der Arbeitnehmer zweitens vorzutragen, dass der Arbeitgeber die geleisteten Überstunden ausdrücklich oder konkludent angeordnet, geduldet oder nachträglich gebilligt hat. Diese vom Bundesarbeitsgericht entwickelten Grundsätze zur Verteilung der Darlegungs- und Beweislast für die Leistung von Überstunden durch den Arbeitnehmer und deren Veranlassung durch den Arbeitgeber werden durch die auf Unionsrecht beruhende Pflicht zur Einführung eines Systems zur Messung der vom Arbeitnehmer geleisteten täglichen Arbeitszeit nicht verändert.
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 04.05.2022 – 5 AZR 359/21
Insolvenzanfechtungsrecht - BGH zur Rückgewährklage eines Insolvenzverwalters nach Insolvenzanfechtung: Zahlungsunfähigkeit als Indiz für den Benachteiligungsvorsatz
Insolvenzanfechtungsrecht - BGH zur Rückgewährklage eines Insolvenzverwalters nach Insolvenzanfechtung: Zahlungsunfähigkeit als Indiz für den Benachteiligungsvorsatz
Das Urteil des BGH vom 24.02.2022 – IX ZR 250/20 enthält neuerliche Ausführungen zu den Anforderungen an den Benachteiligungsvorsatz des Schuldners im Rahmen des § 133 Abs. 1 InsO sowie zu den Tatbestandsmerkmalen der Anfechtung nach den §§ 134, 135 InsO.
Der Leitsatz zu § 133 Abs. 1 S. 1 InsO lautet wie folgt:
Die Zahlungsunfähigkeit stellt nur dann ein Indiz für den Benachteiligungsvorsatz dar, wenn der Schuldner seine Zahlungsunfähigkeit erkannt hat. Hält der Schuldner eine Forderung, welche die Zahlungsunfähigkeit begründet, aus Rechtsgründen für nicht durchsetzbar oder nicht fällig, steht dies einer Kenntnis entgegen, sofern bei einer Gesamtwürdigung der Schluss auf die Zahlungsunfähigkeit nicht zwingend nahelegt.
Hintergrund
Der Kläger ist Insolvenzverwalter in dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der K-GmbH. Das Stammkapital der Schuldnerin betrug € 25.000,00. Die Beklagte war Gesellschafterin der Schuldnerin und ursprünglich in Höhe von € 24.250,00 am Stammkapital der Schuldnerin beteiligt.
Am 23. Juli 2015 schlossen die Beklagte und die Schuldnerin als Lizenznehmerin einen Lizenzvertrag, wonach die Beklagte für bestimmte Patente, Marken und Know-How eine ausschließliche Lizenz erteilte. Die Schuldnerin versprach eine jährliche Lizenzgebühr in Höhe von € 180.000,00, von der zunächst € 15.000,00 zur Auszahlung kommen sollten. Zudem bestimmte der Vertrag, das in 2015 die anteilige Lizenzgebühr in Höhe von € 15.000,00 spätestens zum 31.12.2015 fällig wird. Am selben Tag schlossen die Schuldnerin und die Beklagte eine gesonderte Rangrücktrittsvereinbarung. Diese bestimmte, dass von der Forderung aus dem Lizenzvertrag € 15.000,00 von der Schuldnerin bezahlt werden und über die verbleibenden € 165.000,00 die Beklagte mit allen gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüchen aus und im Rang hinter sämtliche Ansprüche aller gegenwärtigen und zukünftigen Gläubiger der Schuldnerin zurücktritt. Am 22. Februar 2016 überwies die Schuldnerin € 15.000,00 unter Bezugnahme auf den Lizenzvertrag an die Beklagte.
Am 10. Juni 2016 stellte die Schuldnerin einen Insolvenzantrag. Das Insolvenzgericht eröffnete das Insolvenzverfahren mit Beschluss vom 21. September 2016 und bestellte den Kläger zum Insolvenzverwalter. Der Kläger verlangt die Rückzahlung der am 22. Februar 2016 gezahlten € 15.000,00. Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt. Auf die Berufung der Beklagten hat das OLG die Klage hinsichtlich des Anfechtungsanspruchs abgewiesen. Mit seiner zugelassenen Revision strebt der Kläger die Wiederherstellung des erstinstanzlichen Urteils an. Diese Revision hat Erfolg.
BGH: Schuldner muss seine Zahlungsunfähigkeit erkennen
In den Entscheidungsgründen wiederholt der BGH zunächst seine Ausführungen, wonach die subjektiven Tatbestandsmerkmale der Vorsatzanfechtung, da es sich um innere, den Beweis nur uneingeschränkt zugängliche Tatsachen handelt, meist nur mittelbar aus objektiven Tatsachen hergeleitet werden können. Soweit dabei Rechtsbegriffe wie die Zahlungsunfähigkeit betroffen sind, muss deren Kenntnis außerdem oft aus der Kenntnis von Anknüpfungstatsachen erschlossen werden. Diese Anknüpfungstatsachen sind sodann vom Tatrichter zu würdigen. Der Benachteiligungsvorsatz kann nicht allein darauf gestützt werden, dass der Schuldner im Zeitpunkt der angefochtenen Rechtshandlung erkanntermaßen zahlungsunfähig war. Hinzukommen muss dann, dass der Schuldner weiß oder in Kauf nimmt, auch künftig seine Gläubiger nicht befriedigen zu können.
Allerdings stellt die Zahlungsunfähigkeit nur dann ein Indiz für den Gläubigerbenachteiligungsvorsatz dar, wenn der Schuldner seine Zahlungsunfähigkeit erkannt hat. Ob der Schuldner seine Zahlungsunfähigkeit erkannt hat, hängt in erster Linie davon ab, ob er die Tatsachen kennt, welche die Zahlungsunfähigkeit begründen, und ob die gesamten Umstände zwingend auf eine eingetretene Zahlungsunfähigkeit hinweisen. Hierzu muss der Schuldner nicht nur die Forderung kennen, sondern auch deren Fälligkeit. Hält der Schuldner eine Forderung, welche die Zahlungsunfähigkeit begründet, aus Rechtsgründen für nicht durchsetzbar oder nicht fällig, steht dies einer Kenntnis entgegen, sofern bei einer Gesamtwürdigung der Schluss auf die Zahlungsunfähigkeit nicht zwingend naheliegt. Der Schluss auf die Zahlungsunfähigkeit liegt zwingend nahe, wenn sich ein redlich denkender, der vom Gedanken auf den eigenen Vorteil nicht beeinflusst ist, angesichts der ihm bekannten Tatsachen der Einsicht nicht verschließen kann, der Schuldner sei zahlungsunfähig.
Vorliegend ging die Schuldnerin im Zeitpunkt der angefochtenen Zahlung nicht davon aus, zahlungsunfähig zu sein. Aufgrund der schwierigen und streitigen Rechtsfragen durfte die Schuldnerin auch davon ausgehen, dass die gegen sie gerichteten Forderungen nicht fällig waren. Die Schuldnerin hatte damals ihre Zahlungsunfähigkeit jedenfalls nicht erkannt, der Schluss auf das Vorliegen der Zahlungsunfähigkeit war im entscheidenden Fall nicht zwingend. Da vom Kläger keine weiteren Indizien vorgelegt wurden, die einen Gläubigerbenachteiligungsvorsatz gestützt hätten, wurde § 133 Abs. 1 InsO vom BGH verlangt.
Fazit
Bereits mit dem Urteil vom 06.05.2021 – IX ZR 72/20 – hat der neunte Zivilsenat des BGH seine Rechtsprechungsänderung zur Vorsatzanfechtung nach § 133 InsO eingeleitet. Kernaussage dieser Entscheidung war, dass für das Vorliegen des Tatbestandsmerkmals des Gläubigerbenachteiligungsvorsatzes die Kenntnis des Schuldners erforderlich ist, auch künftig seine Gläubiger nicht vollständig bezahlen zu können. Diese Rechtsprechungsänderung wurde mit dem bereits von uns vorgestellten Urteil vom 10.02.2022 – IX ZR 148/19 – konkretisiert. Danach fehlt einem Anfechtungsgegner, der nur das Zahlungsverhalten des Schuldners ihm gegenüber kennt, in der Regel der für die Beurteilung einer drohenden Zahlungsunfähigkeit erforderliche Überblick über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Schuldners. Weitere Konkretisierungen insbesondere zu den Anforderungen an den Gläubigerbenachteiligungsvorsatz des Schuldners enthalten die ebenfalls von uns vorgestellten Urteile vom 24.02.2022 – IX ZR 2050/20 sowie vom 03.03.2022 – IX ZR 53/19.
Insolvenzanfechtungsrecht - BGH zur Relevanz der insolvenzrechtlichen Überschuldung im Rahmen der Vorsatzanfechtung
Insolvenzanfechtungsrecht - BGH zur Relevanz der insolvenzrechtlichen Überschuldung im Rahmen der Vorsatzanfechtung
Der BGH hat in mehreren Entscheidungen die Voraussetzungen der Vorsatzanfechtung im Sinne des § 133 InsO konkretisiert und die Anforderungen an den Insolvenzverwalter für den Nachweis der subjektiven Merkmale erhöht, wie wir bereits in den vorangegangenen Blogs berichtet haben. Diese Linie führt der BGH nun auch in seiner Entscheidung vom 03.03.2022 – IX ZR 53/19 – fort.
Hintergrund
In dem Fall ging es um die Frage, welche Bedeutung der insolvenzrechtlichen Überschuldung für den Gläubigerbenachteiligungsvorsatz des Schuldners und die Kenntnis des Anfechtungsgegners von diesem Vorsatz zukommt. Die Karlsruher Richter stellten zunächst klar, dass die insolvenzrechtliche Überschuldung insoweit ein eigenständiges Beweisanzeichen darstellt. Seine Stärke hängt davon ab, mit welcher Wahrscheinlichkeit die Überschuldung den Eintritt der Zahlungsunfähigkeit des Schuldners erwarten lässt und wann der Eintritt bevorsteht. Insolvenzrechtlich überschuldet ist ein Rechtsträger, der nicht über ausreichend Vermögen verfügt, um seine bestehenden Verbindlichkeiten zu decken. Hinzutreten muss, dass die Fortführung des Unternehmens bis zum Ende eines zwölfmonatigen Prognosezeitraums nicht überwiegend wahrscheinlich ist. Eine negative Fortführungsprognose ist nach dem späteren Eintritt der Zahlungsunfähigkeit wahrscheinlich. Die Zahlungsunfähigkeit kann unmittelbar bevorstehen, sie kann aber auch erst am Rande des Prognosezeitraums eintreten. Es bedarf daher zusätzlicher, in der Art und Weise der Rechtshandlung liegender Umstände, um den Gläubigerbenachteiligungsvorsatz des Schuldners zu begründen. Mit Blick auf die Kenntnis des Anfechtungsgegners würde es nicht genügen, dass der Gläubiger, hier das Finanzamt, weiß, dass der Schuldner bilanziell überschuldet ist. Für die Annahme einer Überschuldung fehlt es nämlich an einer gesetzlichen Vermutung, weshalb der nach § 133 Abs. 1 InsO anfechtende Insolvenzverwalter den Eintritt der insolvenzrechtlichen Überschuldung voll beweisen muss.
Vortrag zur negativen Fortführungsprognose erforderlich
Dies gilt auch für die negative Fortführungsprognose. Kumulativ ist erforderlich, dass die insolvenzrechtliche Überschuldung dem Anfechtungsgegner bekannt geworden ist. Auf diesem zum Grundsatz soll der Insolvenzverwalter darlegen und beweisen. Der Nachweis der insolvenzrechtlichen Überschuldung wird im Anfechtungsprozess grundsätzlich nicht durch eine Handelsbilanz erleichtert, die einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag ausweist. Im Anfechtungsprozess ist daher nicht ausreichend, dass der Verwalter nur eine rechnerische Überschuldung darlegt, da daneben eine negative Fortführungsprognose und die Kenntnis des Anfechtungsgegners von dieser erforderlich sind. Vom außenstehenden Gläubiger kann nämlich nicht erwartet werden, dass er Umstände darlegt, dies aus damaliger Sicht rechtfertigten, das schuldnerische Unternehmen fortzuführen. Vielmehr ist grundsätzlich der Verwalter gehalten, zur negativen Fortführungsprognose vorzutragen. Dies gilt gleichermaßen für den Nachweis der Kenntnis des Anfechtungsgegners von der Überschuldung, selbst wenn diesem eine solche Handelsbilanz bekannt geworden ist.
Fazit
Der BGH hat die Voraussetzungen der Vorsatzanfechtung nach § 133 InsO also auch mit dieser Entscheidung erheblich verschärft. Der Beobachtungs- und Erkundigungsobliegenheit, die Verwalter in der Praxis oft sehen bzw. unterstellen, hat er eine gründliche Absage erteilt. Eine rechtliche Prüfung insolvenzanfechtungsrechtlicher Rückforderungsansprüche dürfte die Verteidigungschancen künftig weiter erhöhen.
Unsere auf das Insolvenzrecht spezialisierten Anwälte stehen Ihnen in Bezug auf das Insolvenzanfechtungsrecht kompetent zur Verfügung.
Insolvenzanfechtungsrecht – BGH zum Gläubigerbenachteiligungsvorsatz bei Sanierungsversuch
Insolvenzanfechtungsrecht – BGH zum Gläubigerbenachteiligungsvorsatz bei Sanierungsversuch
Bezahlt ein Unternehmen einen Sanierungsberater für ein Konzept, um die Insolvenz abzuwenden, liegt dem BGH zufolge nicht ohne weiteres der Vorsatz, andere Gläubiger zu benachteiligen, vor. Vielmehr müsse der Insolvenzverwalter darlegen und beweisen, dass das Sanierungskonzept von vornherein untauglich war und diese Tatsache dem Schuldner auch bekannt war. Die Insolvenzanfechtung eines Beraterhonorars in Höhe von rund 4,5 Mio. € ist daher vorläufig fehlgeschlagen.
BGH, Urteil vom 03.03.2022 – IX ZR 78/20
Hintergrund
Nach dem Einbruch im Photovoltaik-Markt geriet der weltweit agierende Konzern „Q-CELLS“ im Jahr 2011 in eine finanzielle Krise. Es wurde eine Rechtsanwaltsgesellschaft engagiert, um ein Sanierungskonzept zu erstellen. Um die Insolvenz zu vermeiden, riet die Sanierungsberaterin, dass Verbindlichkeiten aus Wandelschuldverschreibungen in Eigenkapital umgewandelt werden. Dafür musste jeder einzelne Anleihe-Gläubiger seine Zustimmung erteilen. Die Gläubigerversammlung stimmte zwar mehrheitlich zu, aber bestimmte Gläubiger erhoben Anfechtung- und Nichtigkeitsklagen.
Die Rechtsanwaltsgesellschaft stellte für die Beratungstätigkeit laufend Rechnungen in Höhe von insgesamt rund 4,5 Mio. €, die von dem Konzern auch beglichen wurden. Sie erhielten keine Angaben über die konkret abgerechneten Tätigkeiten. Nach knapp vier Monaten stellte Q-CELLS aber doch einen Insolvenzantrag. Der Insolvenzverwalter forderte das Honorar des Sanierungsberaters zurück. Das LG Frankfurt am Main gab der Klage statt, das OLG Frankfurt setzt die Rückzahlungssumme auf rund 0,5 Mio. € herab. Beide Parteien wandten sich an den BGH.
Gläubigerbenachteiligungsvorsatz bei Rettungsversuch
Unternimmt ein Unternehmen einen Versuch, die Insolvenz abzuwenden, indem es einen Sanierungsberater engagiert, muss der Insolvenzverwalter dem BGH zufolge für die Anfechtung der Honorarzahlung nach § 133 Abs. 1 InsO darlegen. Auch müsse er beweisen, dass dieser Sanierungsversuch von vornherein (ex ante Betrachtung) untauglich war und dem Konzern das auch bewusst war. Dabei komme es zum einen darauf an, ob der Berater als kompetent anzusehen und ob das Konzept rechtlich vertretbar ist. Dabei sei ein großzügiger Maßstab anzulegen. Dazu gehört laut dem BGH aber mindestens, auch die Ursache der Krise zu behandeln und nicht nur die akute Liquiditätslücke zu beseitigen.
Honorarzahlung ohne Angabe der konkreten Tätigkeit
Die Karlsruher Richter bekräftigten zugleich, dass ein Rechtsanwalt und sein Mandant frei sind, vertraglich zu vereinbaren, wie die Rechnungen aussehen sollen. Vereinbarten die Parteien also, dass diese ohne nähere Angaben zu der abgerechneten Tätigkeit fällig und durchsetzbar sind, sei § 10 Abs. 2 RVG insoweit abdingbar.
Fazit
Auch hier erschwert der BGH seine Anforderungen an die Vorsatzanfechtung nach § 133 Abs. 1 InsO, in dem er verlangt, dass der Insolvenzverwalter konkret darlegen und beweisen muss, dass das Sanierungskonzept von vornherein untauglich war und diese Tatsache dem Schuldner auch bekannt war. Das Urteil passt also in die Reihe der neuerlich veröffentlichten Rechtsprechungen, die an den Tatbestand der Vorsatzanfechtung höhere Anforderungen stellen.